 Beispiel: Sterbefallzahlen in der 51. Kalenderwoche 2020 24 % über dem Durchschnitt der Vorjahre
Beispiel: Sterbefallzahlen in der 51. Kalenderwoche 2020 24 % über dem Durchschnitt der Vorjahre
Nach vorläufigen Ergebnissen sind in der 51. Kalenderwoche (14. bis 20. Dezember 2020) in Deutschland mindestens 23 550 Menschen gestorben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, liegen die Sterbefallzahlen somit in diesem Zeitraum etwa 24 % oder 4 568 Fälle über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. In der Vorwoche lagen die Sterbefallzahlen nach aktuellem Stand 25 % über dem Vorjahresdurchschnitt. Dies geht aus einer Sonderauswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen hervor, die aktuell bis zur 51. Kalenderwoche zur Verfügung steht.
711 COVID-19-Todesfälle mehr als in der Vorwoche
Die Zahl der Todesfälle von Personen, die zuvor laborbestätigt an COVID-19 erkrankt waren, steigt seit Anfang Oktober von Woche zu Woche an. In der 51. Kalenderwoche gab es insgesamt 4 484 beim Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete COVID-19-Todesfälle. Das waren 711 Fälle mehr als noch in der Vorwoche.
Sterbefälle in Sachsen im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre mehr als verdoppelt
Besonders auffällig ist die Entwicklung der Sterbefallzahlen weiterhin in Sachsen. Die Differenz zum Durchschnitt der vier Vorjahre nimmt dort seit Oktober von Woche zu Woche deutlich zu. In der 41. Kalenderwoche (5. bis 11. Oktober 2020) lag die Zahl der Sterbefälle noch unter dem Durchschnitt. In der 51. Kalenderwoche hat sich die Zahl bezogen auf den Durchschnittswert der vier Vorjahre für diese Woche mehr als verdoppelt (+109 % oder 1 226 Fälle). Auch in Brandenburg (+41 % oder 267 Fälle), Hessen (+32 % oder 428 Fälle) und Thüringen (+36 % oder 215 Fälle) lag die Zahl der Sterbefälle zuletzt mindestens 30 % über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019.
Deutliche Befunde zur Übersterblichkeit in anderen europäischen Ländern
Das EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen meldet derzeit für die 51. Kalenderwoche eine außergewöhnlich hohe Übersterblichkeit („extraordinary high excess“) für die Schweiz und Slowenien. Eine hohe Übersterblichkeit („high excess“) wird für Italien, die Niederlande, Österreich und Portugal gemeldet. In anderen europäischen Ländern stellt EuroMOMO für diese Kalenderwoche maximal eine mäßige („moderate excess“) Übersterblichkeit fest.
Methodische Hinweise zu den Sterbefallzahlen für Deutschland:
Eigene Auswertungen der Sterbefallzahlen sind auf Basis der Sonderauswertung „Sterbefälle – Fallzahlen nach Tagen, Wochen, Monaten, Altersgruppen, Geschlecht und Bundesländern für Deutschland 2016 bis 2020“ möglich. Für das Jahr 2020 werden erste vorläufige Daten dargestellt. Bei den vorläufigen Daten handelt es sich um eine reine Fallzahlauszählung der eingegangenen Sterbefallmeldungen aus den Standesämtern ohne die übliche Plausibilisierung und Vollständigkeitskontrolle der Daten.
Durch gesetzliche Regelungen zur Meldung von Sterbefällen beim Standesamt und Unterschiede im Meldeverhalten der Standesämter an die amtliche Statistik sind aktuelle Aussagen zur Zahl der Sterbefälle mit einem Verzug von etwa vier Wochen möglich. Durch die verzögerten Meldungen werden sich die vorliegenden Ergebnisse für das Jahr 2020 noch leicht erhöhen.
Neben den direkten und indirekten Folgen der COVID-19-Pandemie können auch Verschiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung zu überdurchschnittlichen Sterbefallzahlen beitragen. Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie können allerdings auch dafür sorgen, dass weniger Sterbefälle durch andere Infektionskrankheiten wie beispielsweise die Grippe verursacht werden, was sich ebenfalls auf die Differenz zum Durchschnitt auswirkt. Über die Häufigkeit einzelner Todesursachen können die Sterbefallzahlen jedoch keine Auskunft geben.
Anhand der vorläufigen Sterbefallzahlen können Phasen der Übersterblichkeit identifiziert werden. Für eine abschließende Einordnung der Sterblichkeitsentwicklung eines Jahres werden die Sterbefälle unter anderem ins Verhältnis zur Bevölkerung gesetzt, um beispielsweise auch den Alterungsprozess der Bevölkerung adäquat einzubeziehen. Die dafür erforderlichen endgültigen Ergebnisse werden Mitte des Jahres 2021 vorliegen.
Die vorläufigen Sterbefallzahlen beziehen sich auf den Sterbetag, nicht auf das Meldedatum. Da die gemeldeten COVID-19-Todesfälle vom RKI nach Sterbetag ebenfalls mit einem Verzug von vier Wochen veröffentlicht werden, ist ein zeitlicher Vergleich mit den vorläufigen Gesamt-Sterbefallzahlen möglich.
Weitere Informationen:
Weitere Informationen zur Sonderauswertung der tagesgenauen Sterbefallzahlen finden Sie auf der Themenseite „Sterbefälle und Lebenserwartung“, der Sonderseite „Corona-Statistiken“ und im Podcast „Sterbefallzahlen und Übersterblichkeit während der Corona-Pandemie“ des Statistischen Bundesamtes.
(Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell)











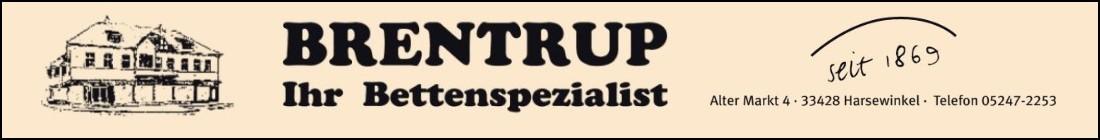




























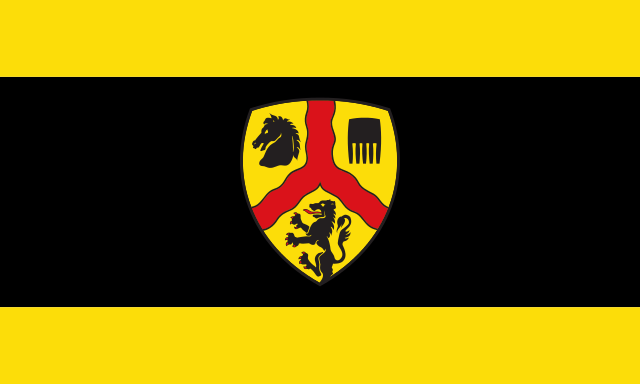
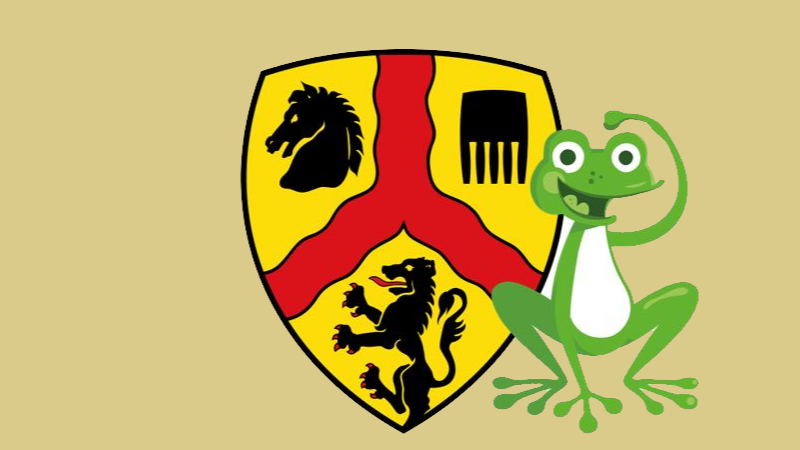 Anmeldungen aufgrund der Coronapandemie grundsätzlich schriftlich durchführen
Anmeldungen aufgrund der Coronapandemie grundsätzlich schriftlich durchführen


 Bestellungen auch weiterhin per Mail möglich
Bestellungen auch weiterhin per Mail möglich
 Das was? Na, das Spöggsken!
Das was? Na, das Spöggsken!