Die Ministerin betonte die Herausforderungen des Klimawandels für die Wasserversorgung. „Die Verfügbarkeit von Wasser, insbesondere sauberem Trinkwasser, ist keine Selbstverständlichkeit. Dies haben die trockenen Sommer der vergangenen Jahre gezeigt.“ Potenzielle Nutzungskonflikte müssten vorausschauend vermieden werden. So soll der Vorrang der Trinkwasserversorgung im Landeswassergesetz verankert werden. Zudem erarbeitet das Umweltministerium im Rahmen einer Konzeption für langanhaltende Trockenphasen konkrete Maßnahmen und Lösungsansätze.
Neue Broschüre „(Unter-)Wasserwelten“
Die Vereinten Nationen haben den Weltwassertag 2021 unter das Motto „Wert des Wassers“ gestellt. Passend zum Anlass hat das Umweltministerium eine neue Broschüre rund um die „(Unter-)Wasserwelten“ in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Die Broschüre bietet spannende Fakten rund um die Bäche, Flüsse und Seen in Nordrhein-Westfalen – etwa zur Wanderung der Aale in die ferne Sargassosee oder dem Balztanz des Bitterlings. „Wer die Natur kennt, wird sich mit besonderer Begeisterung für ihren Schutz einsetzen. Mit der neuen Broschüre möchten wir den Blick für das Leben im und am Wasser schärfen“, so Heinen-Esser.
50.000 Kilometer Fließgewässer
Nordrhein-Westfalen durchzieht ein Netz von Fließgewässern mit einer Länge von rund 50.000 Kilometern. Dem „Mythos Rhein“ und seiner Geschichte widmet sich die Broschüre mit einem eigenen Kapitel. Unter anderem gibt die Broschüre Einblicke in die Arbeit eines der letzten Rheinfischer auf einem „Aal-Schokker“. Erfreulicherweise wandern heute wieder Lachse und Maifische den Rhein hinauf zu ihren Laichgründen. Dies ist ein sichtbarer Erfolg für den Gewässerschutz sowie von Renaturierungsmaßnahmen und Wiederansiedlungsprojekten.
„Der Trend stimmt, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. An den Gewässern in Nordrhein-Westfalen sind 150 Jahre Industriegeschichte nicht spurlos vorübergegangen. Wir dürfen nicht nachlassen, uns mit aller Kraft für die Ressource Wasser und vitale und widerstandsfähige Flussgebiete einzusetzen“, so Heinen-Esser. Im Entwurf des Maßnahmenprogramms zum Bewirtschaftungsplan 2022-2027 für die Flussgebiete Rhein, Weser, Ems und Maas sind über 10.000 Maßnahmen geplant, um die Qualität der Gewässer in Nordrhein-Westfalen weiter zu verbessern.
Flussperlenmuschel und nachhaltige Aquakultur
Informationen bietet die neue Broschüre zu den verschiedenen Lebensräumen und ihren Bewohnern. Wie vielfältig die natürlichen Verflechtungen dabei sein können, zeigt die Flussperlmuschel. Diese bis zu 120 Jahre alten Süßwassermuscheln sind bei der Fortpflanzung auf Bachforellen angewiesen, damit sich ihre Larven in den Kiemen der Fische festsetzen und entwickeln können. Aufgrund ihrer kostbaren Perlen setzte im 19. Jahrhundert eine massive Jagd nach den Muscheln ein, die beinahe zum Aussterben der Art in Nordrhein-Westfalen führte. Ein von EU und Land unterstütztes Artenschutzprojekt in der Eifel brachte im Jahr 2020 erstmals wieder geschlechtsreife Muscheln hervor.
Ein weiterer Schwerpunkt der Broschüre ist die „Regionale Aquakultur“. Viele Fischbestände in den Weltmeeren sind heute schon überfischt. Um auch in Zukunft den Bedarf nachhaltig decken zu können, werden Aquakulturen den Wildfang zunehmend ersetzen. Zur Erforschung und Entwicklung von zukunftsweisenden Lösungsansätzen plant die Landesregierung am Standort Kirchhundem-Albaum eine Modernisierung und Stärkung der Bereiche Fischereiökologie und Aquakultur des Landesumweltamtes durch ein modernes Kompetenzzentrum mit modernen Laboren und neuer Teichanlage.
Download und Bestellmöglichkeit der Broschüre:
Unter www.mulnv.nrw.de kann die neue Broschüre „(Unter-)Wasserwelten – Bäche, Flüsse und Seen in Nordrhein-Westfalen“ heruntergeladen werden. Auch eine Bestellung von gedruckten Exemplaren ist dort möglich.
Direkt-Link zu der neuen Broschüre:https://www.umwelt.nrw.de/mediathek/broschueren/detailseite-broschueren?broschueren_id=14749&cHash=abafbd9d05ad1f5bd39b659323299c47
(Text- und Bildquelle: Land NRW)











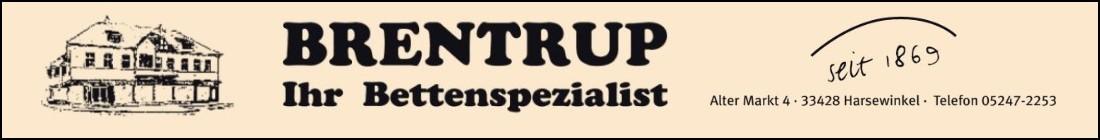



























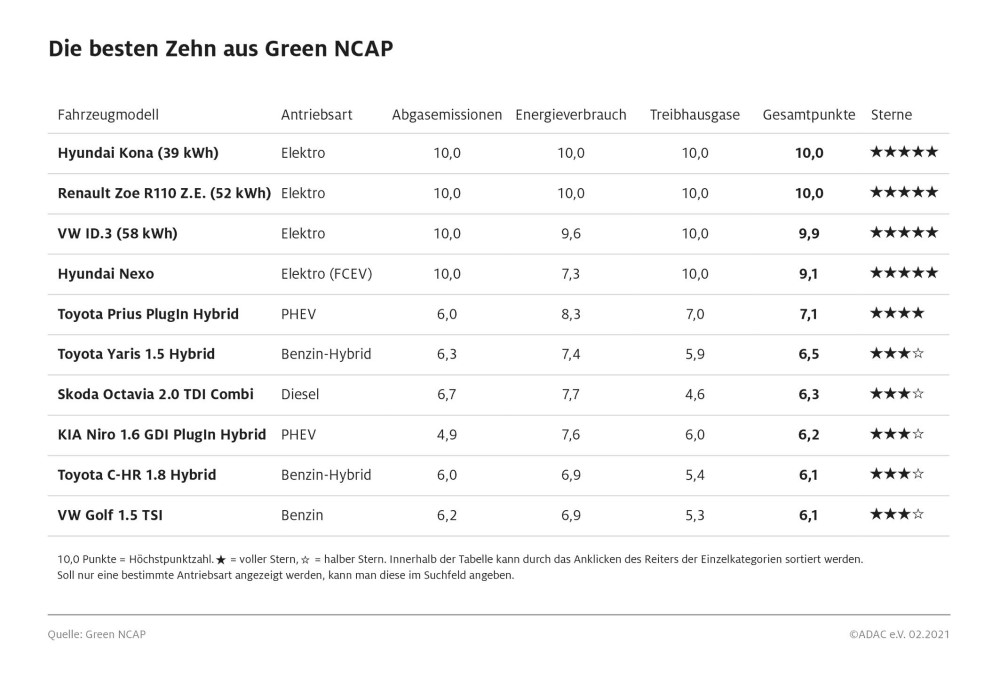

 Bei
Bei 
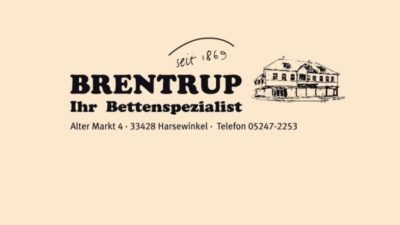




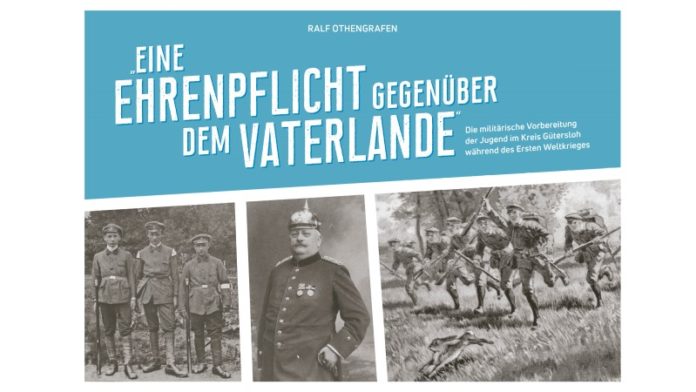
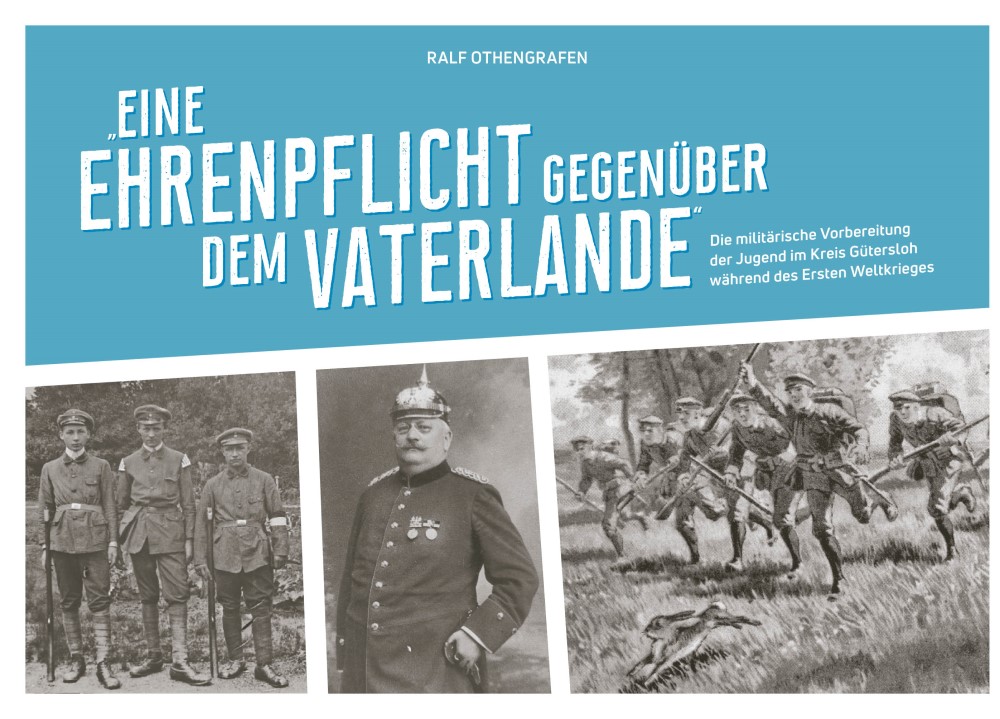


 Vorausgesetzt, Bund und Land geben grünes Licht zur weiteren Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff, dann läuft das Impfzentrum Gütersloh rasch wieder auf Volllast. Personen, deren Termin in dieser Woche ausgefallen ist, werden vom Impfzentrum des Kreises kontaktiert um einen neuen Termin in der kommenden Woche zu finden. Schulen, Kitas oder anderen Einrichtungen, die sich als Gruppe angemeldet haben, werden über ihre Einrichtung vom Impfzentrum benachrichtigt.
Vorausgesetzt, Bund und Land geben grünes Licht zur weiteren Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff, dann läuft das Impfzentrum Gütersloh rasch wieder auf Volllast. Personen, deren Termin in dieser Woche ausgefallen ist, werden vom Impfzentrum des Kreises kontaktiert um einen neuen Termin in der kommenden Woche zu finden. Schulen, Kitas oder anderen Einrichtungen, die sich als Gruppe angemeldet haben, werden über ihre Einrichtung vom Impfzentrum benachrichtigt. Das was? Na, das Spöggsken!
Das was? Na, das Spöggsken!