 11,2 Tonnen – so hoch ist laut Statistik der jährliche Pro-Kopf-Ausstoß an Kohlendioxid in Deutschland. Damit hinterlässt jeder und jede einen vergleichsweise riesigen CO2-Fußabdruck, allein 1,7 Tonnen durch die Ernährung. Die gute Nachricht: Bis zu 40 Prozent davon lassen sich einsparen. Wie das geht und noch dazu gesund und lecker sein kann, zeigt der neue Ratgeber der Stiftung Warentest Klimafreundlich essen mit der CO2-Challenge. Mit 50 nachhaltigen Rezepten und vielen alltagstauglichen, leicht umsetzbaren Tipps erklärt Autor Christian Eigner, wie sich rund um das Thema Ernährung Treibhausgas-Emissionen einsparen lassen.
11,2 Tonnen – so hoch ist laut Statistik der jährliche Pro-Kopf-Ausstoß an Kohlendioxid in Deutschland. Damit hinterlässt jeder und jede einen vergleichsweise riesigen CO2-Fußabdruck, allein 1,7 Tonnen durch die Ernährung. Die gute Nachricht: Bis zu 40 Prozent davon lassen sich einsparen. Wie das geht und noch dazu gesund und lecker sein kann, zeigt der neue Ratgeber der Stiftung Warentest Klimafreundlich essen mit der CO2-Challenge. Mit 50 nachhaltigen Rezepten und vielen alltagstauglichen, leicht umsetzbaren Tipps erklärt Autor Christian Eigner, wie sich rund um das Thema Ernährung Treibhausgas-Emissionen einsparen lassen.
Gleich zu Beginn des Buches kann jeder und jede mit einem Test herausfinden, wie groß der eigene Fußabdruck ist – um ihm dann mit der CO2-Challenge zu Leibe zu rücken. Wie bei einer Diät sollen überflüssige (Kohlendioxid)-Pfunde purzeln. Nur werden hier nicht Kalorien gezählt, sondern Treibhausgas-Emissionen. „Jedes Lebensmittel, das im Supermarkt oder Bioladen angeboten wird, hat bereits einen CO2-Fußabdruck hinterlassen, der bei seiner Herstellung und dem Transport zum Händler entstanden ist.“, sagt Autor Christian Eigner. Für die eigene Klimabilanz ist es deshalb besser, schon bei der Auswahl auf Lebensmittel mit kleinem Fußabdruck zu achten. Wie man die erkennt, energiesparend lagert und weiterverarbeitet, erklärt Eigner in fünf anschaulich aufbereiteten Kapiteln, garniert mit leichtverdaulichen Infohappen für konkrete CO2-Sparmaßnahmen im Alltag.
Passend dazu entwickelte die Ernährungs-Expertin Astrid Büscher 50 leckere und klimafreundliche Rezepte. Viele basieren auf bekannten Originalen, bei denen die tierischen Zutaten ersetzt oder der Anteil minimiert wurde. Zu jedem Rezept wird der CO2-Fußabdruck pro Portion angegeben und, wann immer sinnvoll, auch die Einsparung gegenüber den Originalen. So spart zum Beispiel die Zubereitung von Hähnchen Stroganoff im Vergleich zu Rinderfilet Stroganoff pro Portion 7,52 kg CO2. Das entspricht rund 50 Kilometer Autofahren – und einem stattlichen Minus in der persönlichen CO2-Bilanz.
Das Buch lädt Leserinnen und Leser dazu ein, sich der Challenge zu stellen und ab sofort auf kleinerem (CO2-)Fuß zu leben. Mitmachen lohnt sich. Wer sich an die Klima-Diät hält, ernährt sich nicht nur bewusster und gesünder, sondern wird sich auch insgesamt wohler fühlen. Denn Studien belegen: ökologisches Verhalten steigert die Lebenszufriedenheit.
Christian Eigner ist freier Journalist und Autor mit dem Schwerpunkt Verbrauchthemen. Er arbeitet regelmäßig für die Zeitschriften test und Finanztest und hat bereits mehrere Ratgeber verfasst.
Astrid Büscher hat in Hamburg Ökotrophologie studiert. Sie arbeitet als Nährwertexpertin und ist Autorin gesundheitsorientierter Kochbücher – auch für die Stiftung Warentest.
Das Buch „Klimafreundlich essen mit der CO2-Challenge“ hat 176 Seiten und ist für 20 Euro ab dem 13. Dezember 2022 im Handel erhältlich oder online unter www.test.de/co2-diaet.
(Text- und Bildquelle: test.de)











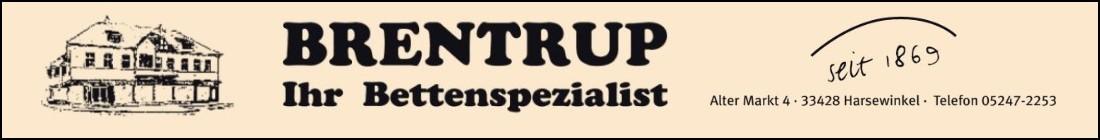































 Sitzung der Lokalen Agenda Umwelt am Dienstag, den 3.1.2023 im Heimathaus Harsewinkel, ab 18.00 Uhr. Von 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr geht es um aktuelle Projekte, alle mit dem Ziel, Biodiversität in Harsewinkel zu erhalten und zu verbessern.
Sitzung der Lokalen Agenda Umwelt am Dienstag, den 3.1.2023 im Heimathaus Harsewinkel, ab 18.00 Uhr. Von 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr geht es um aktuelle Projekte, alle mit dem Ziel, Biodiversität in Harsewinkel zu erhalten und zu verbessern.




 Am heutigen 31. Dezember kannst Du mit zum Abschluss des diesjährigen Advents- & Silvesterkalenders noch einmal Deine Chance nutzen und mit dem Spöggsken einen Familien-Terminplaner für das Jahr 2023 und das superwitzige Spiel Looping Louis gewinnen!
Am heutigen 31. Dezember kannst Du mit zum Abschluss des diesjährigen Advents- & Silvesterkalenders noch einmal Deine Chance nutzen und mit dem Spöggsken einen Familien-Terminplaner für das Jahr 2023 und das superwitzige Spiel Looping Louis gewinnen!
 Das was? Na, das Spöggsken!
Das was? Na, das Spöggsken!