
Wie gelingt es einem großen Kommunalverband, seine Liegenschaften klimaneutral zu bewirtschaften und als innovativer Vorreiter ehrgeizige Klimaziele zu erreichen? Und wie können Kommunalverband und Energiewirtschaft dabei erfolgreich zusammenarbeiten? Diese und andere Fragen erörterten, auf Einladung von Westenergie, Matthias Löb, Direktor des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL), seine Kollegen Hendrik Kohl und Bodo Strototte mit Jürgen Grönner, Geschäftsführer Westnetz, Dietmar Ewering, Innovationsmanagement Westnetz, sowie Saskia Kemner und Monika Schürmann vom Kommunalen Partnermanagement der Westenergie, der Muttergesellschaft von Westnetz.
Bis 2030 will der LWL klimaneutral werden. Durch Gebäudesanierungen und Umrüstung der älteren Energiezentralen sind zwar seit 1990 schon ca. 60 Prozent der CO2-Emissionen reduziert worden – die letzten 40 Prozent in einem Bestand mit 1.400 Gebäuden haben es aber in sich. Der LWL hat sich daher bereits auf den Weg gemacht, geeignete Dachflächen mit Photovoltaik nachzurüsten. Die Vertreterinnen und Vertreter von Westnetz und Westenergie stellten den Verbandsvertretern beim Besuch in der Smarten Betriebsstelle in Metelen weitere Möglichkeiten vor, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Aber auch die Themen E-Mobilität und „Smart Poles“, die „intelligenten Straßenlaternen“ waren Thema des Austausches. Die LED-Straßenleuchten strahlen nicht nur, sondern sind darüber hinaus auch Ladesäule für E-Mobilität, verfügen über eine digitale Hinweistafel und ermöglichen dem Umfeld die Einwahl in ein kostenloses WLAN-Netz. Auch das Produkt „Gridx“ wurde vorgestellt, mit dem eine intelligente, zentrale Steuerung der Gebäude-Technik ermöglicht wird.
Ein zentraler Punkt bei der weiteren CO2-Reduzierung ist Wasserstoff. „Bereits heute gibt es kein Gespräch zwischen uns und Vertretern der Kommunen, bei dem es nicht auch um das Thema Wasserstoff geht“, erklärte Saskia Kemner, Leiterin Kommunales Partnermanagement Region Münster/Ostwestfalen-Lippe. „Wir sind ein großer und leistungsfähiger Kommunalverband. Wir möchten daher auch bei Nachhaltigkeitsthemen eine Vorreiterrolle einnehmen“, sagte Matthias Löb. „Neben Sonne und Wind in der Energieerzeugung ist für uns die Wasserstofftechnologie als Medium mit langfristigen Speichermöglichkeiten hoch interessant.“
„Westnetz steht für hohe technische Kompetenz bei Planung und Betrieb von Strom- und Gasnetzen. So machen wir die Energiewende möglich. Das Ziel ist grün, aber der Weg dorthin ist mehrfarbig“, erläuterte Jürgen Grönner mit Blick auf die verschiedenen Typen der Wasserstofferzeugung. Sauber verbrennender Wasserstoff, der aus grünem Strom produziert wurde, ist der optimale Energiespeicher. Mit Wasserstoffantrieben machen Kommunen und Stadtwerke ihren Fuhrparkt CO2-neutral und bringen ihre Umweltbilanz nach vorne. Die eigene Wasserstofftankstelle inklusive Wasserstofferzeugung auf Basis von Ökostrom schafft nicht nur Vorteile Fördermittel zu erhalten, sondern bindet auch ihre lokalen Stromerzeugungsanlagen aus dem kommunalen Querverbund ein.
Wasserstoff verbrennt nicht nur sauber, er lässt sich auch als Stromspeicher nutzen: Mittels der Technologie Power-to-Gas wird Wasser in seine zwei Bestandteile aufgespalten, Sauerstoff und Wasserstoff. Das passiert im sogenannten Elektrolyseur. Der synthetische Wasserstoff funktioniert dann als Speicher für Energie – und das effizienter als eine Batterie.
Welche Vorteile Wasserstoff als zentraler Energieträger auch für den Landschaftsverband bietet, konnte in der „Smarten Betriebsstelle“ in Metelen direkt praxistauglich besichtigt werden. Die Westnetz-Betriebsstelle bietet den optimalen Rahmen, um diese Zukunftslösungen zu präsentieren. Die Netzbetriebsstandort arbeitet autark, d. h. unabhängig von einer äußeren Energieversorgung. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach liefert den Strom. Dieser wird auf zwei Wegen gespeichert. Für den kurzfristigen Bedarf werden durch die Sonnenenergie die Batteriespeicher im Keller gefüllt. Wenn diese geladen sind, wird mit der Sonnenenergie ein eigener Elektrolyseur betrieben, der Wasserstoff herstellt. Dieser Wasserstoff wird auf dem Betriebshof in Tanks gelagert und dient so als Langzeitspeicher. Wenn keine Sonne scheint, wird dieser Wasserstoff eingesetzt, um mit einer eigenen Brennstoffzelle wieder Strom zu erzeugen. Auch die Abwärme dieser Brennstoffzelle wird genutzt, um die Brennwerttherme der Heizungsanlage zu speisen.
„Eine beeindruckende Technik. Wir werden nun prüfen, inwieweit wir ein solches Modell an einem Schulzentrum oder auf einem Klinikgelände berücksichtigen können“, zeigte sich Matthias Löb nach der Besichtigung interessiert.
(Text- und Bildquelle: Oer/Westenergie)











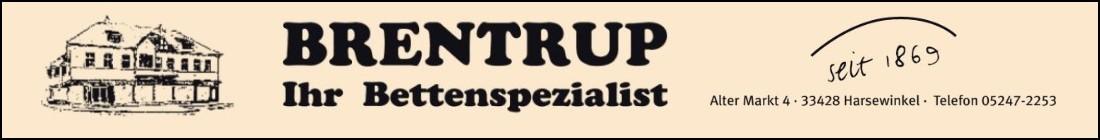

















 Das was? Na, das Spöggsken!
Das was? Na, das Spöggsken!